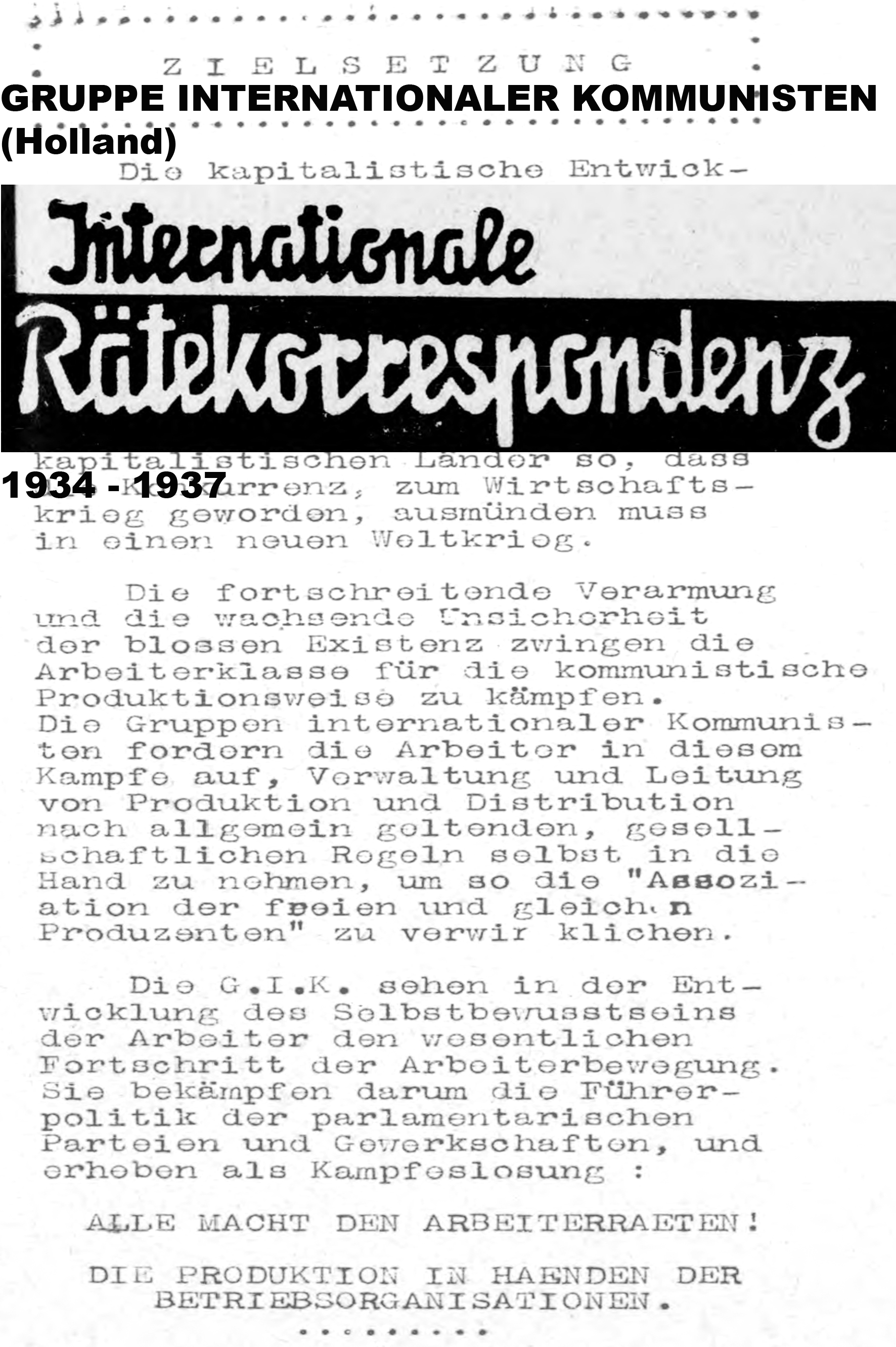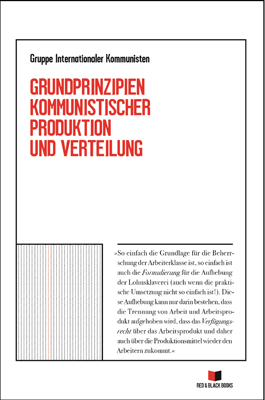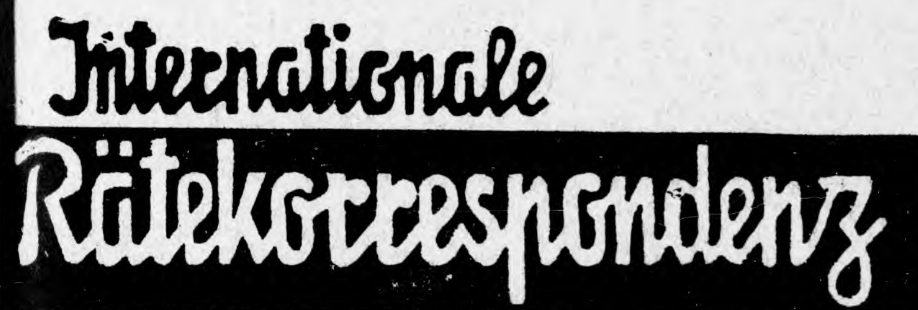
“ZIELSETZUNG
Die kapitalistische Entwicklung führt stets heftigere Krisen, die in einer stets größeren Erwerblosigkeit und einer immer tiefer gehenden Erschütterung der Wirtschaft zum Ausdruck kommen. Millionen Arbeiter werden dadurch von der Produktion ausgeschaltet und dem Hunger preisgegeben. Zugleich verschärfen sich die Gegensätze der verschiedenen kapitalistischen Länder so, daß die Konkurrenz, zum Wirtschaftskrieg geworden, ausmünden muß in einen neuen Weltkrieg.
Die fortschreitende Verarmung und die wachsende Unsicherheit der bloßen Existenz zwingen die Arbeiterklasse für die kommunistische Produktionsweise zu kämpfen. Die Gruppen Internationaler Kommunisten fordern die Arbeiter in diesem Kampfe auf, Verwaltung und Leitung von Produktion und Distribution nach allgemein geltenden, gesellschaftlichen Regeln selbst in die Hand zu nehmen, um so die ‘Association der freien und gleichen Produzenten’ zu verwirklichen.
Die G.I.K. sehen in der Entwicklung des Selbstbewußtseins der Arbeiter den wesentlichen Fortschritt der Arbeiterbewegung. Sie bekämpfen darum die Führerpolitik der parlamentarischen Parteien und Gewerkschaften und erheben als Kampfeslosung:
ALLE MACHT DEN ARBEITERRÄTEN!
DIE PRODUKTION IN HÄNDEN DER BETRIEBSORGANISATIONEN!”
Raetekorrepondenz Nr. 1 bis Nr. 22
(digitalisiert nach Vorlage)
Raetekorrespondenz Nr. 1 Juni 1934
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
I. Die Zusammenbruchstheorie des Kapitalismus.
II. Die Wirtschaftslage im Nationalsozialismus.
Raetekorrespondenz Nr. 2 Juli 1934
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
I. Der historische Materialismus.
II. Hitler-Deutschland im Zeichen des Zusammenbruchs.
III. Thesen über den Kampf um die Arbeiterräte.
Raetekorrespondenz Nr. 3 August 1934
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
Thesen über den Bolschewismus
I. Die Bedeutung des Bolschewismus.
II. Die Voraussetzungen der russischen Revolution.
III. Die Klassengruppierungen der russischen Revolution.
IV. Das Wesen des Bolschewismus.
V. Richtpunkte der bolschewistischen Politik.
VI. Der Bolschewismus und die Arbeiterklasse.
VII. Die bolschewistische Revolution.
VIII. Der Internationalismus der Bolschewiken und die nationale Frage.
IX. Der verstaatlichte Bolschewismus und die Komintern.
X. Der Bolschewismus und die internationale Arbeiterklasse.
Raetekorrespondenz Nr. 4 September 1934
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
I. Zur Marxschen Akkumulations- und Zusammenbruchstheorie.
(In Erwiderung des Artikels: “Die Zusammenbruchstheorie des Kapitalismus.”
in Nummer 1 der “Rätekorrespondenz”)
1. Vom “rein-ökonomischen” Standpunkt?
2. Die Akkumulation im Lichte der marxschen Dialektik.
3. Das grossmannsche Reproduktionsschema.
4. Akkumulation um der Akkumulation Willen.
5. Der grossmann’sche “Schnitzer”.
6. Grossmann contra Marx.
7. Der historische Materialismus.
8. Die neue Arbeiterbewegung.
II. Die Intelligenz im Klassenkampf.
III. Der Kampf gegen die Herabsetzung der Erwerbslosen-Unterstützung in Amsterdam.
Raetekorrespondenz Nr. 5 Oktober 1934
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
I. Arbeiterräte und kommunistische Wirtschaftsgestaltung.
1. Der Weg zurück.
2. Lohnarbeit und Staatswirtschaft.
3. Proletarische Problemstellung.
4. Die Arbeiterräte.
5. Kommunistische Wirtschaft.
II. Vom Okzident zum Orient.
Raetekorrespondenz Nr. 6 November 1934
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
Zur Neuordnung der deutschen Arbeitsverfassung.
a. Allgemeine Bemerkungen.
b. Übersicht über die wichtigsten Einzelbestimmungen.
I.
II.
III.
Raetekorrespondenz Nr. 7 Februar 1935
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
I. Grundlagen des Gelben Imperialismus
1. Die japanische Exportoffensive.
2. Japan in Europa.
3. Uebergang zum Kapitalexport.
4. Britisch-Japanischer Handelskrieg.
5. Die Kriegserklärung an das weiße Kapital.
6. Die technischen Voraussetzungen der japanischen Expansion.
7. Das “Währungsdumping”
8. Lebenshaltung.
9. Frauen- und Kinderarbeit.
10. Agrarkrise in Permanenz.
11. Der japanische Staat.
12. Schluss.
13. Nachtrag.
II. Bemerkungen über die Arbeiterbewegung in Deutschland.
III. Die Raete in der deutschen Revolution.
1. Die Entwicklung des Rätegedankens.
2. Die Voraussetzungen der Räte.
3. Die Räte vor der Revolution.
4. Die Räte in der Revolution.
5. Räte und Leitung der Produktion.
Raetekorrespondenz Nr. 8/9 April/Mai 1935
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
I. Das Werden einer neuen Arbeiterbewegung
1. Die Ohnmacht
2. Die Klasse ‘an sich’ und die Klasse ‘für sich’.
3. Der Nationalsozialismus.
4. Der Kampf für die demokratischen Rechte.
5. Klassenkampf und Kommunismus.
6. Die Selbstbewegung der Massen.
a) Bedeutung der Massenbewegung.
b) Die Ausdehnung.
c) Die Beherrschung der Klassenkräfte durch die Arbeiterräte.
7. Die neue Arbeiterbewegung.
8. Die Arbeitsgruppen.
9. Die “Kinderkrankheiten”.
10. Zusammenfassung.
II. Thesen über Staat und Partei.
Raetekorrespondenz Nr. 10/11 Juli/August 1935
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
II. Das Werden einer neuen Arbeiterbewegung (kritische Bemerkungen)
Raetekorrespondenz Nr. 12 September 1935
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
I. Die Gegensätze zwischen Luxemburg und Lenin.
1. Gegen den Reformismus.
2. Um die nationale Frage.
3. Zur Frage des Spontanitätsmomentes und der Rolle der Organisation.
Raetekorrespondenz Nr. 13 Oktober 1935
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
I. Die Entwicklung der russischen Außenpolitik von 1917 - 1935.
1. Die Periode der Revolution.
2. Die erste Niederlage der bolschewistischen Außenpolitik.
3. Die Periode des Bürgerkrieges.
4. Die Wendung zur nationalen Selbstbehauptung.
5. Der Eintritt in die internationale Diplomatie.
6. Russland wird zum Faktor der internationalen Großmachtpolitik.
7. Die Pazifizierung der russischen Westplitik.
8. Kurswechsel nach Osten.
9. Die Erledigung der chinesischen Arbeiterrevolution.
10. Auf dem Wege zum Völkerbund.
11. Die innerpolitischen Voraussetzungen der letzten Etappe der russischen Außenpolitik.
12. Die Liquidierung der Komintern.
13. Schluss.
II. Bericht aus Dänemark.
Raetekorrespondenz Nr. 14 Dezember 1935
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
I. Der Bergarbeiterstreik in Belgien Mai 1935.
1. Der Zustand vor dem Streik.
2. Der Streik.
3. Das Abwürgen des Streiks durch die Gewerkschaft.
4. Die Staatsmacht greift ein.
5. Der Bergarbeiterstreik ist beendet.
6. Schlusswort.
II. Klassenkampf im Kriege.
1. Der Zweite Weltkrieg ist unabwendbar.
2. Die ideologische Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges.
3. Die “Arbeiterbewegung” als Kriegshetzer.
4. Nationale Unabhängigkeit und Leninismus.
5. Die IV. Internationale (Trotzkistische Opposition der III. Internationale) und der Leninismus.
6. Verhinderung des Krieges.
7. Der Feind steht im eigenen Lande.
Raetekorrespondenz Nr. 15 März 1936
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
II. Probleme der neuen Arbeiterbewegung.
III. Kommunismus und Religion.
Raetekorrespondenz Nr. 16/17 Mai 1936
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
I. Riesenaussperrung in Dänemark.
II. Differenzen in der Rätebewegung über die Entwicklungstendenzen im Kapitalismus.
1. Schriftstücke der deutschen Genossen.
a) Worauf kommt es an?
b) Von kapitalistischer zu kommunistischer Produktionsweise.
c) Die Entwicklung zum Staatskapitalismus.
2. Resolution der Brüsseler Konferenz.
3. Antwort der GIKH.
4. Erwiderungen der amerikanischen Genossen.
5. Erwiderungen der dänischen Genossen.
6. Anti-Kritik der deutschen Genossen.
7. Staatskapitalismus und Diktatur.
Raetekorrespondenz Nr. 18/19 September 1936
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
I. Massenstreik in Frankreich.
Raetekorrespondenz Nr. 20 Dezember 1936
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
I. Sovjet-Russland von heute.
1. Kritik an den Kritikern.
2. Ein wesentliches Moment in der Entwicklung Russlands in den letzten Jahren.
3. Die Lage der Kräfte im gegenwärtigen Russland.
a) Die Verhältnisse in der Agrarwirtschaft.
b) Die Lage der Arbeiter.
c) Die Stachanov-Bewegung.
d) Die neue Verfassung.
4. Staatskapitalismus und Kommunismus.
II. Das gelobte Land (Bericht aus Palästina)
III. Der Aufstand der Araber in Palästina.
Raetekorrespondenz Nr. 21 April 1937
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
I. Der Anarcho-Syndikalismus und die spanische Revolution.
1. Die Feuerprobe des Anarchismus.
2. Die Macht in den Betrieben.
3. Die ausländische Hilfe erdrosselt die Revolution.
4. Der Klassenkampf im “roten” Spanien.
5. Die ökonomische Organisierung der Revolution.
6. Die Übernahme der Produktion durch die Gewerkschaften.
7. Der Anarcho-Syndikalismus.
8. Die Notwendigkeit einer planmäßigen Produktion.
9. Bolschewistische oder kommunistische Organisation.
II. Hilferuf
III. Ein Brief aus Deutschland.
Raetekorrespondenz Nr. 22 Juli 1937
Theoretisches - und Diskussionsorgan für die Rätebewegung
Ausgabe der Gruppe internationaler Kommunisten - Holland
I. Revolution und Konterrevolution in Spanien.
1. Die allgemeine Bilanz.
2. Die Haltung der CNT vor dem 3. Mai.
3. Die Haltung der CNT während der Maitage.
4. Die Folgen der Liquidation.
II. Die Pariser Konferenz.
Bei Amazon erhältlich:
Hans-Peter Jacobitz und Thomas Königshofen (Hrsg.):
„Gruppe Internationaler Kommunisten (Holland):
Internationale Pressekorrespondenz“.
504 Seiten, Dezember 2020, EUR 13,41
ISBN 979-8551636052
Mit der Oktoberrevolution 1917 in Russland war für Kommunisten in aller Welt ein neues Zeitalter angebrochen. Die Jahrtausende währende Unterdrückung und Ausbeutung der Masse der Menschheit durch eine kleine Ausbeuterklasse schien beendet zu sein. Wie ein Lauffeuer erwartete man die Ausbreitung der Revolution über die ganze Welt. In wenigen Jahren sollte der Spuk des Kapitalismus und des Feudalismus überall beendet sein.
Bekanntlich kam es anders als erwartet. Zwar gab es einige kommunistische Aufstände, die aber nach wenigen Wochen von der Reaktion niedergeschlagen wurden. Und in Russland, der späteren Sowjetunion, entwickelte sich eine von der Kommunistischen Partei beherrschte Staatsmacht, die es einerseits zuließ, dass sich die kleinen Bauern zu Kleinkapitalisten entwickelten, und andererseits als Staatskapitalisten eine Arbeiterschaft zu einer riesigen Lohnarbeitermannschaft zusammenfasste, die für die Staatszwecke ihre Arbeitskraft abliefern durfte. Der Kerngedanke einer sozialistischen Revolution, die Selbstverwaltung der Ökonomie durch die Arbeiter, die Schaffung von Räten (Sowjets), wurde immer weiter in den Hintergrund gedrängt. Stattdessen entwickelte sich schon unter Lenin ein riesiger Staatsapparat, der mit allen Formen der Gewalt das gemeine Volk kontrollierte und oppositionelle Standpunkte bekämpfte. Anstelle der Planung der Weltrevolution beschränkte die damalige Sowjetunion die auswärtigen kommunistischen Parteien auf eine Rolle als Auslandsvertretung, die die Interessen der Sowjetunion im diplomatischen Spiel mit den Weltmächten vertreten sollten.
Diese Perversion des kommunistischen Gedankens wurde Vorbild für „sozialistische“ Revolutionen überall in der Welt. Ende des 20. Jahrhunderts fand diese Form des Sozialismus sein Ende. Unter den sog. Realsozialisten setzte sich die Anschauung durch, dass ein richtiger Kapitalismus mit richtigem Privateigentum die herrschende Klasse und ihre betreuende Staatsmacht erheblich glücklicher machen könne als ihre merkwürdige Konstruktion einer sozialistischen Gesellschaft.
Kritische Stimmen gegen diese Art der „sozialistischen“ Betreuung von Menschen und Ökonomie gab es unmittelbar nach der Übernahme der Herrschaft in Russland durch die Bolschewiki. In Deutschland spaltete sich schon bald – aufgrund des Verhaltens der KPD während des Kapp-Putsches und unterschiedlicher Auffassungen über die bürgerliche Demokratie und den leninistischen Parteiaufbau - die Kommunistische Arbeiterpartei von der KPD ab. Später gab es noch die Kommunistische Arbeiterunion bzw. die Allgemeine Arbeiterunion mit ähnlicher Stoßrichtung. Interessant zu bemerken ist, dass die KAPD zeitweise mehr Mitglieder hatte als die bekannte KPD. Gemeinsam war diesen Parteien und Unionen die Kritik an den oben beschriebenen Entwicklungen in der Sowjetunion. Dagegen setzten sie ihr Konzept der Organisation der sozialistischen Gesellschaft, die Rätegesellschaft. In ihr sollen die Menschen frei von jeder Staatsgewalt über ihre gemeinsamen Anliegen bestimmen können. Dabei berufen sich die Rätekommunisten auf die Urväter des wissenschaftlichen Sozialismus, Karl Marx und Friedrich Engels. Sie schrieben bereits im Kommunistischen Manifest von 1848: „An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für freie Entwicklung aller ist.“
In den Niederlanden gründeten Kommunisten die Kommunistische Arbeiterpartei Hollands, die eng mit der deutschen KAP zusammenarbeitete. Da die holländischen Kommunisten die Parteistruktur der KAP kritisierten, weil sie der Meinung war, dass eine Partei dem Geiste des Rätekommunismus widerspreche, entstand 1927 die „Gruppe Internationale Kommunisten“. Nach dem Zerfall der KAPD spätestens 1933 mit der Machtübernahme Hitlers erlangte die GIK eine hervorragende Bedeutung in der internationalen Rätebewegung; bedeutende Rätekommunisten wie Anton Pannekoek, Paul Mattick, Helmut Wagner oder Henk Canne Meijer veröffentlichten in den Presseorganen der GIK theoretische Grundlagen der Rätebewegung, beschrieben praktische Auswirkungen auf den Kampf der Arbeiterklasse und entwarfen ein Bild einer kommunistischen Gesellschaft auf Grundlage des Rätekommunismus.
In den Jahren 1934 bis 1937 gab die GIK eine unregelmäßig erscheinende deutschsprachige Zeitschrift, die „Internationale Rätekorrespondenz“ heraus, die in 22 Ausgaben die gesamte Weltsicht der Rätekommunisten dokumentierte. In dem hier angekündigten Buch werden sämtliche Ausgaben der Internationalen Rätekorrespondenz dem Interessierten zur Lektüre überlassen. Die Herausgeber haben in Zusammenarbeit mit der Association Archives Antonie Pannekoek (A.A.A.P.) in Brüssel und dem International Institute for Social History in Amsterdam (IISG) die zum Teil kaum noch lesbaren Reproduktionen der Zeitschrift transkribiert und korrigiert sowie mit Vor- und Nachwort versehen
Das Studium der schon fast 90 Jahre alten Schriften kann eine theoretische Grundlage für aktuelle soziale Bewegungen sein. Hierzu ein Zitat aus dem Nachwort: „Aktuell sind dezentrale Bewegungen zu beobachten, die ganz bewusst die Regeln der demokratischen erlaubten Meinungsäußerung verletzen, indem sie nach ihrer Diagnose von menschenunfreundlichen Umständen zur Tat schreiten. Aktionen gegen die kapitalistische Benutzung und Zerstörung von Natur und Umwelt oder gegen die profitorientierte Wohnraumbewirtschaftung werden von Betroffenen gemeinsam und eigenständig organisiert, wobei sie sich gegenüber politischen Einrichtungen, die den Protest vereinnahmen wollen, äußerst misstrauisch verhalten. Sie weigern sich, Spielball oder Wahlkampfmunition von herrschenden Parteien und Institutionen zu sein, die ihrer Ansicht nach die beklagten Verhältnisse zu verantworten haben. Eine große Rolle für die Vernetzung der rebellischen Gruppen spielen alternative lokale Zeitungen, die die Aktivitäten unterstützen und publizieren.
Natürlich gibt es immer noch gewerkschaftlich organisierte Lohnkämpfe, die sich aber weniger durch eine kompromisslose Strategie der Durchsetzung von Forderungen auszeichnen. Hingegen will die Gewerkschaft in den Auseinandersetzungen mit den Arbeitgebern ihre Rolle als anerkannter Partner in der Betreuung sozialpolitischer Konflikte bestätigt sehen.
Aus rätekommunistischer Sicht gibt es auch heute keine guten Gründe, Kompromisse mit Staat und Kapital zu schließen. Sie führen alle auf die Unterwerfung unter die Berechnungen kapitalistischer Kalkulationen oder die Gewalt des Staatsapparates hinaus. Dagegen fordern Rätekommunisten eine neue, selbst gestaltete Gesellschaft, deren Attraktivität nicht zu verleugnen ist.“
HENRICI
untergrundblättle
Marxistische Debatte: Wie geht Planwirtschaft
Anmerkungen zum Artikel von Sabrina Zimmermann
„Marxistische Debatte: Wie geht Planwirtschaft?“
Streit über kommunistische Planwirtschaft
Die „Rätekorrespondenz“ aus den 1930ern regt zu neuer Korrespondenz an.
Lose Texte zum Raetekommunismus
Karl Marx / Friedrich Engels
Manifest der Kommunistischen Partei
Das Kapital Bd. I.
Kritik des Gothaer Programms
Johann Most
Der kommunistische Anarchismus
Die anarchistischen Kommunisten an das Proletariat
Die freie Gesellschaft
Kapital und Arbeit
Wladimir Lenin
Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus
Der “Linke Radikalismus”, die Kinderkrankheit im Kommunismus
Gegenstandpunkt
100 Jahre Russische Revolution
Rückblick auf einen unverzeihlichen Fehler
100. Jahrestag der Oktoberrevolution
Stalin - Wer war das?
Michail Gorbatschow: Der Totengräber des Realen Sozialismus
Ein aktueller, aber falscher Klassiker:
Lenin, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus
Erich Mühsam
Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat
(www. libertaereszentrum.de)
Anton Pannekoek
Bolschewismus und Demokratie
Sozialdemokratie und Kommunismus
Über Arbeiterräte
Arbeit und Muße
Gruppe Internationaler Kommunisten
Groep Internationale Communisten
Grondbeginselnen der communistische productie en distributie (niederländisch)
Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung. (Übersetzung aus dem Niederländischen: Hermann Lueer).
Red & Black Books, 2020, ISBN 3982206545, 9783982206547, 340 Seiten